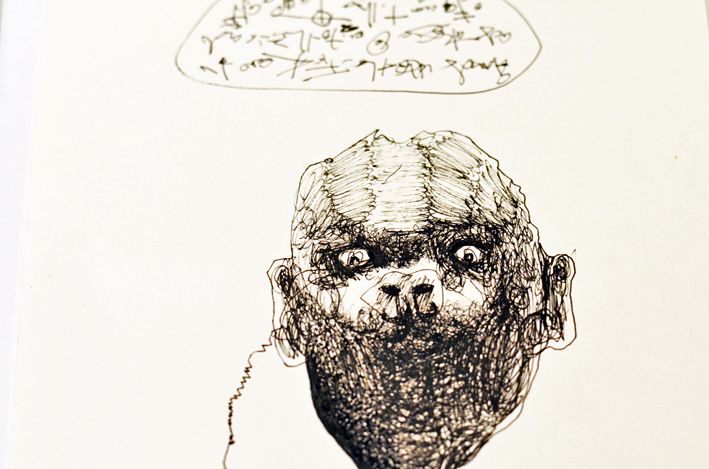Manchmal ist das Leben ein schmerzliches Unterfangen. Man muss zum Zahnarzt, die Steuererklärung abgeben, Abschiede hinnehmen. Es läuft nicht immer so, wie man es sich wünscht. Die Menschen in Syrien, Irak, Afghanistan, Pakistan können ein Lied davon singen. In diesem Augenblick scheint die Sonne, dann WUFF. Vorbei. Die Liebsten getroffen.
Donnerstag wollte Viveka kommen. Um 17 Uhr. Als sie um 18.30 Uhr noch nicht da war, habe ich angerufen. Niemand wusste, wo sie war. “Ihre Tasche steht hier, die Handtasche.” Ich wusste nicht. Ruhig bleiben. Dann kam sie zur Tür rein, nahm den Hörer. Ihre Mutter. Ein Herzinfarkt. Anruf des Vaters. Notarzt, Krankenhaus, Intensivstation. Das ganze Programm. Reanimation, Kampf.
Ich komme, sofort. Eigentlich wäre sie gekommen, aber sie konnte nicht. Mit Ela konnte ich nicht sprechen, sie war im Yogaunterricht. Zoe und Jim meinten: Fahr, wir kommen klar. Wie viele dieser Anrufe treffen uns in einem Leben?
Meinen ersten Anruf erhielt ich 1978. Da war ich dreizehn und Klassensprecher der Klasse 7A der staatlichen Realschule Cochem. “Beatrix ist gestern Abend gestorben. Ein Verkehrsunfall, wir besuchen ihre Mutter, kommst du mit?” Klar. Klassensprecher, Verantwortung. Ich war klein, blond, knuffig. Ihre Mutter hat mich nicht mehr losgelassen. Später sind wir in die Kirche zum Sarg. Ich wusste nicht, dass der Sarg offen sein würde. Das Bild habe ich nicht vergessen. Es war die Zeit, als mein Vater nach seinem Schlaganfall gerade aus der Reha zurückgekommen war. Nach zwei Jahren, halbseitig gelähmt. Manchmal ist das Leben Krieg.
Gestern, um 14:59 Uhr starb Vivekas Mama. Ich saß im Wartezimmer der Intensivstation, als Viveka heraus kam. Das Zickzack der grünen Linie hatte aufgehört. Von 107 auf 0. Eine letzte Bewegung. Unfassbar. Was sagt man angesichts des Schmerzes? Wie Trost spenden?
Von der einen auf die andere Sekunde. Ohne Vorwarnung, ohne Rücksicht, ohne eine Hand, die führt, trägt. Parallel Telefonate mit meiner Mutter, die auch im Krankenhaus liegt, weil das Herz Sachen macht. Normalerweise wäre ich zu ihr gefahren, hätte sie besucht. Es geht ihr gut, es scheint, als liefe alles auf einen Herzschrittmacher hinaus. Sie lebt. Vivekas Mutter ist gestorben und ihr Schmerz tut weh. Mir.
Ich konnte Viveka ein wenig tragen, ablenken, behilflich sein, da sein. Das, was sich machen, tun lässt. Wenig. Man kann es nicht von den Schultern nehmen, den Weg durch das Tal nicht mitgehen. Dieser Tod ist eine verfluchte Scheiße. Kein Wort ist in der Lage, dem gerecht zu werden.
Die Zeit kommt, wenn die Zeit gekommen ist. Zu früh, viel zu früh. Völlig inakzeptabel. Es hilft nichts. Keine Beschwerde nirgendwo. Die Woche beginnt, der Montag kommt. Busse fahren, Geschäfte öffnen, Zeitungen melden. Das ganze Programm. Beerdigungsinstitut, Versicherungen, Ämter. Beschäftigungstherapie, Ablenkung. Machen, tun. Verzweifeln, weinen, Mut fassen, den Blick nach vorne richten. Beschwichtigen, das Gute sehen. Dankbar sein für das Vergangene. Der Tod ist der grausamste Teil des Lebens. Er kommt öfter, je älter man wird.
Die Bilder bewahren, die Spuren im Ich, den Klang der Worte, die lebendigen Erinnerungen, die Eindrücke aller Sinne. Das Küssen auf die Wange, das Leuchten der Augen, der Klang der Stimme, diese Art und Weise, Dinge zu tun. Je mehr wir geliebt werden, desto größer der Schmerz. An diesem Wochenende durfte ich erfahren, wie sehr ein Mensch geliebt werden kann. Es waren mindestens 10 Jahre zu wenig. Niemand kann erklären, wo sie geblieben sind. Der Wecker klingelt und es bleibt nichts, als es zu akzeptieren. Das ist Leben in seiner ganzen Konsequenz.