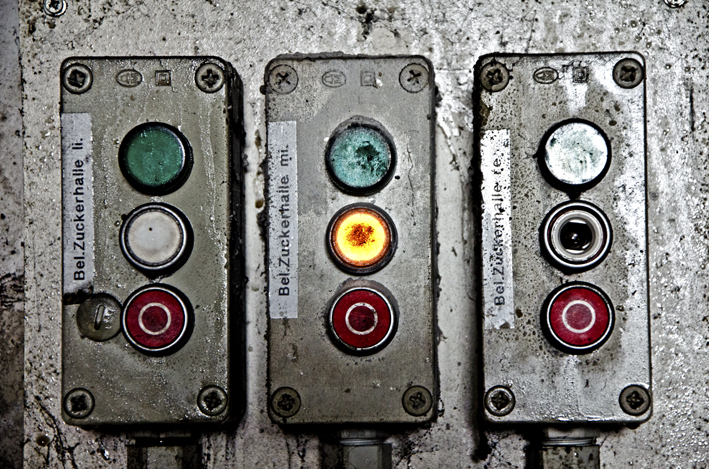Szene: Eine städtisches Flachdach auf einem mittelhohen Hochhaus. Kies als Bodenbelag. Eine geöffnete Dachluke, ein gewölbtes Dachfenster – ein Lichtsammler für den darunter liegenden Flur und die Stiege zum Dach. Oben ein Campingstuhl und ein Rollstuhl. Darin sitzen James und John, zwei Cowboys mit großen Texas-Hüten und Herrenpyjamas. Zwischen sich eine Drücker-Thermoskanne mit Kaffee, zwei Blech-Kaffeebecher und eine halbvolle Flasche Bourbon. Zu ihren Füßen eine Petroleumlampe. Beide haben den Kopf im Nacken und schauen in den Nachthimmel zu den Sternen.
John: Wie damals in der Prärie. Die Kojoten heulen, in der Ferne hörst du die Rothäute schleichen, die Klapperschlangen züngeln und die fallenden Sternschnuppen reichen sich die Hände. Wunschlos glücklich.
James: Wie viel Rinder wir getrieben haben. Es müssen mehr als eine Million gewesen sein.
John: Den Sattel im Rücken, das Feuer, der Kaffee.
James: Und der gute Jack. Cin-Cin.
John: Prosit.
James: Was für eine Plörre. Scheiß Aldi-Whiskey.
John: James?
James: John?
John: James, wir müssen etwas tun.
James: Losreiten.
John: Ja.
James: Das sagst du jedes Mal, wenn wir hier sitzen.
John: Ja.
James: Lass mich rechnen. Seit sieben Jahren sind wir in dieser Einrichtung. Karl-Heinz hat einen Nachtdienst im Monat und lässt uns rauf. Sieben mal Zwölf sind Vierundachtzig. Wie oft willst du noch sagen „Lass uns losreiten“? Bis wir bei Hundert sind?
John: Dann sage ich mal Hundert. Es ist so weit.
James: Klar.
John: James, ich habe einen Plan. Wir ziehen das durch.
James: Einfach rausspazieren, Pferde satteln, losreiten. Wie damals.
John: Ja.
James: Wir sind nicht mehr die Jüngsten und die Räder an meiner Seite machen es auch nicht besser. Geschweige denn das dicke Schloss unten an der Tür. Die lassen uns nicht so einfach gehen. Das hier ist Sing-Sing.
John: Ich habe mit Theresa geschlafen.
James: Der Dicken aus der Küche?
John: Yes.
James: Hart.
John: Viagra.
James: Woher?
John: Karl-Heinz.
James: Hab nix mitbekommen.
John: Dienstag im Vorratsraum, nach dem Küchendienst.
James: Sack.
John: Sie hilft uns.
James: Muss gut gewesen sein.
John: Hör zu. Wir müssen hier raus, sonst geh’n einfach irgendwann die Lichter aus. Willst du in ’ner Zinkwanne hier rausgeschleppt werden? Füße voran? Verbrannt, Urne, Arrividerci?
James: Hast wieder zu viel Italowestern gesehen.
John: Wir ziehen das durch. Theresa lässt uns hinten raus. Sie hat den Schlüssel. Karl-Heinz fährt uns zum Bahnhof. Weg sind wir.
James: Und dann?
John: Überfallen wir den Postzug. Ich habe einen Colt und eine Winchester.
James: Du hast was?
John. Einen Colt, eine Winchester und Munition.
James: Woher?
John: Judith.
James: Du hast nicht auch mit ihr?
John: Ich hatte zwei Pfizers.
James: Was finden die bloß an dir?
John: Das Lächeln, sagen sie. War’s schon immer. Fresse halten und lächeln.
James: Abhauen. Postzug.
John: Wie damals.
James: Das waren Zeiten. Highnoon. Keine Fragen, schießen. Wie viele haben wir weggepustet.
John: Manchmal sehe ich die Kugeln in Zeitlupe fliegen. Langsam durch die Weste. Sehe ihre Augen, wenn sie es realisieren.
James: Harte Zeiten.
John: James, das hier sind harte Zeiten. Die haben uns die Freiheit genommen. Gruppengespräche, bunter Abend, Physiotherapie, Gestaltungstherapie, Gruppenschwimmen, Küchendienst. Hast du dir das so vorgestellt?
James: Wann?
John: Sonntag. Während der Messe.
James: Guter Zeitpunkt. Vier Fäuste für ein Halleluja.
John: Abgemacht?
James: Yes, Sir. Und. Und was wird dann?
John: Wir holen uns die Kohle, stopfen uns die Satteltaschen voll und ab zu Lilly.
James: Vegas. Oh god. Lilly.
John: Hab ihr telegrafiert. Sie hat geantwortet. Hier, lies.
James: Dass es sie noch gibt. Was war die Frau schön.
John: Bei ihr können wir unterkommen. Um alles klar zu machen. Pferde, Sättel, Knarren.
James: Du meinst es ernst.
John: James, ich mach das hier nicht mehr. Ich kann diese Scheiße nicht mehr fressen. Ich will nicht ins Pflegezimmer kommen und da langsam den Löffel abgeben. Mir den Hintern mechanisch abwischen lassen und unter die Decke glotzen, bis es so weit ist. Letzte Ausfahrt Brooklyn. Now or never. Ich will wieder richtigen Jack.
James: Bin dabei. Ja. Ich bin dabei. Wir machen die Biege. Hauen einfach ab. Arsch lecken. Yippie.
John: Und dann nach Wyoming, Sterne zählen.
James: Wyoming. Schlag ein.
John: Wyoming.
Vorhang.